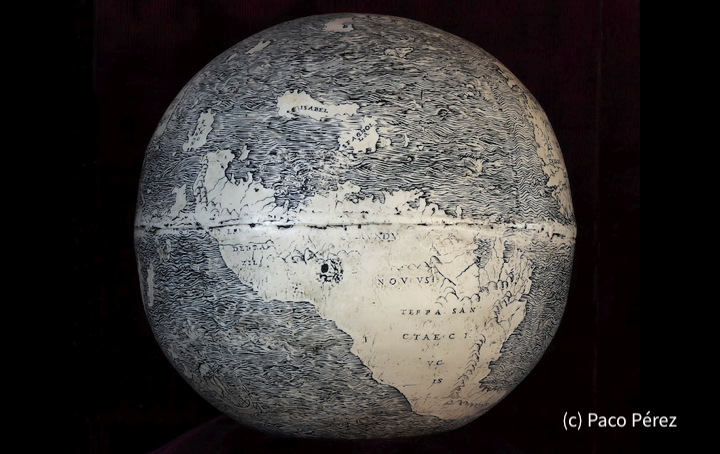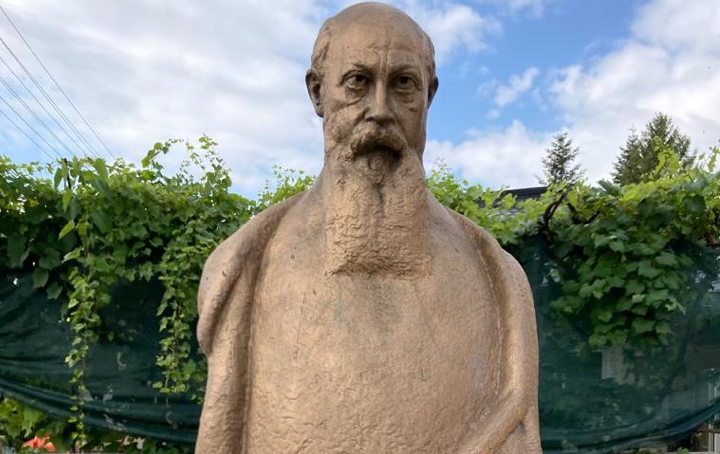Der Schein trügt: Wie ein Kerzenleuchter zum zentralen Objekt des NS-Weihnachtskults wurde
Cordula Engeljehringer
Die Instrumentalisierung harmloser Objekte für politische Zwecke ist keine Seltenheit.
Die wechselhafte symbolische Bedeutung des sogenannten Julleuchters ist ein besonders anschauliches Beispiel dafür, wie frühgeschichtliche Gegenstände für politische Ideologien missbraucht wurden.